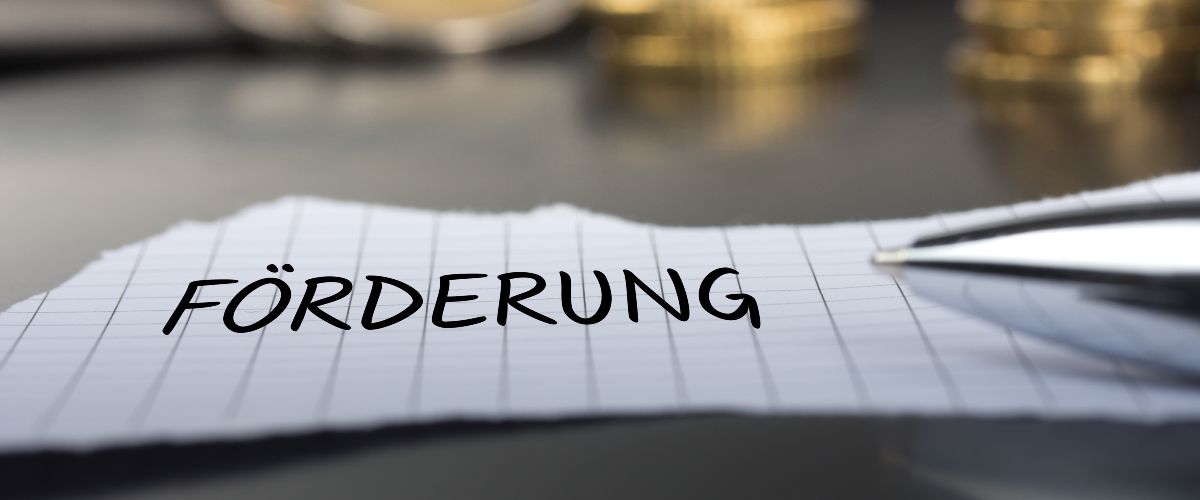Wie durch geförderte Forschungsprojekte starke Innovationen entstehen
Die Forschungsförderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen des 8. Energieforschungsprogramms erfolgt nach wettbewerblichen Prinzipien der Projektförderung. Sie folgt dabei den Empfehlungen der Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI), die insbesondere eine Missionsorientierung und und agile Strukturen für eine durchsetzungsstarke Good Governance als Kernelemente tragfähiger Innovationsförderprogramme angeregt haben. Die Projektförderung wirkt somit als starkes Instrument, um zielgerichtet Innovation, Forschung und Entwicklung in den Bereichen anzuregen, die für die energie- und klimapolitischen Ziele relevant sind. Maßgeblich ist dabei die Anwendungsnähe der Vorschläge.
Zielgerichtete, effiziente und gesteuerte Mittelvergabe entlang energie- und wirtschaftspolitischer Prioritäten
Große Transformationsaufgaben passieren nicht zufällig. Sie bedürfen Planung und Steuerung. Gerade für eine gesellschaftliche Mammutaufgabe wie die Energiewende und das Ziel, bis 2045 ein resilientes und zugleich klimaneutrales Energiesystem zu erreichen, ist die Projektförderung ein besonders wirksames Element von Förderpolitik. So kann das BMWK die verfügbaren Mittel für die Forschung gezielt für dringende technologische Entwicklungen und für energie-, klima- und innovationspolitische Prioritäten einsetzen, beispielsweise für Wasserstofftechnologien oder klimaneutrale Wärmeversorgung. Dies gibt zugleich Unternehmen die notwendige Sicherheit, dass neben den technischen auch die wirtschaftlichen Risiken ihrer Forschung reduziert werden.
Projektförderung ermöglicht Innovationssprünge
Eine Befragung des Projektträgers Jülich im Auftrag des BMWK unter Projektbeteiligten aus dem Jahr 2024 hat gezeigt, dass der technologische Entwicklungsgrad innerhalb der Projektlaufzeit signifikant steigt. Der sogenannte Technology Readiness Level (TRL) steigt durchschnittlich um zwei bis drei Stufen. Zum Vorhabenende erreichen die meisten Projekte somit einen TRL von 6 bis 7. Somit trägt die Projektförderung unmittelbar dazu bei, neue Technologien schneller zu entwickeln.
Schulterschluss zwischen Forschungseinrichtungen und Wirtschaft erhöht die Innovationskraft und stärkt den Standort
Projektförderung fördert Kooperationen zwischen Universitäten, Forschungsinstituten und Unternehmen. Ihr Kern ist in der Energieforschung die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Ergebnisse sind damit durch die beteiligten Wirtschaftspartner direkt praxisnah anwendbar: entweder in Folgeprojekten oder für eine spätere Markteinführung.
Schneller zielgerichteter Transfer von Forschung in die Praxis von Unternehmen und Verbraucher
Durch gezielte Ausschreibungen in der Projektförderung kann der Staat technologische Trends frühzeitig fördern und damit Innovationen schneller auf den Markt bringen. Durch eingebundene Unternehmen in die Förderprojekte ist zudem der Bezug zur energiewirtschaftlichen Praxis sichergestellt.
Höhere Innovationskraft durch Abfederung der technologischen und ökonomischen Risiken bei Unternehmen
Forschung und Entwicklung im Energiebereich sind oft mit hohen Kosten und unsicherem Ausgang verbunden. Direkte Förderungen im Rahmen von Projekten verringern dieses Risiko, indem sie Unternehmen finanzielle Sicherheit bieten. Das gilt insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Projektförderung unterstützt die Risikobereitschaft von Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Das ermöglicht, dass disruptive Technologien entstehen können – denn die Förderung hängt nicht von kurzfristigen Gewinnen ab.
Klar definierter Forschungsfokus und Monitoring der Programmfortschritte
Forschungsteams erarbeiten in Förderprojekten Antworten für klar definierte Fragestellungen. Das schärft die Ziele, die ein Vorhaben erreichen soll. Durch diesen Fokus können schnelle Fortschritte gelingen.
Dynamisches und agiles Instrument der Energie- und Wirtschafspolitik
Die Forschung kann im Rahmen der Projektförderung dynamisch an aktuelle Herausforderungen angepasst werden. Projekte sind üblicherweise für drei oder vier Jahre geplant. Somit kann regelmäßig und zielgerichtet entschieden werden, ob die Forschungsrichtung weiterhin zu den Zielen des spezifischen Missionsfelds passt.
Effektivität und Effizienz der Förderung nachgewiesen durch Evaluierung und Erfolgskontrolle
Projektförderung ist an klare Ziele, Meilensteine und Erfolgsnachweise gebunden. Somit kann der Bund über dieses Instrument den effizienten Einsatz von Steuergeld sicherstellen und zugleich gewährleisten, dass Forschung die notwendigen Innovationen entwickelt, die für die Energiewende essenziell sind.
Auch künftig wirkstark fördern
Jedes politische Förderinstrument hat neben Vorteilen immer auch Raum für Verbesserungspotenziale. Die Befragung des Projektträgers Jülich unter Zuwendungsempfängern brachte vielfach das Feedback, flexiblere Projektstrukturen zu ermöglichen hinsichtlich der Dauer und des Umfangs von Projekten. Diese sollen stärker an Entwicklungszyklen der Wirtschaft angepasst werden. Zugleich sollen Antragsprozesse verschlankt und verkürzt werden.
Im 8. Energieforschungsprogramm setzt das BMWK im Rahmen eines lernenden Programms durch einen Beirat, den Input der Forschungsnetzwerke Energie und nicht zuletzt durch eine umfangreiche Programmevaluation. So entstehen wertvolle Impulse, um das Programm und seine Förderinstrumente kontinuierlich zu optimieren. Zudem setzt das BMWK auf eine enge Zusammenarbeit der angewandten Energieforschung mit den Trägern der Grundlagenforschung.